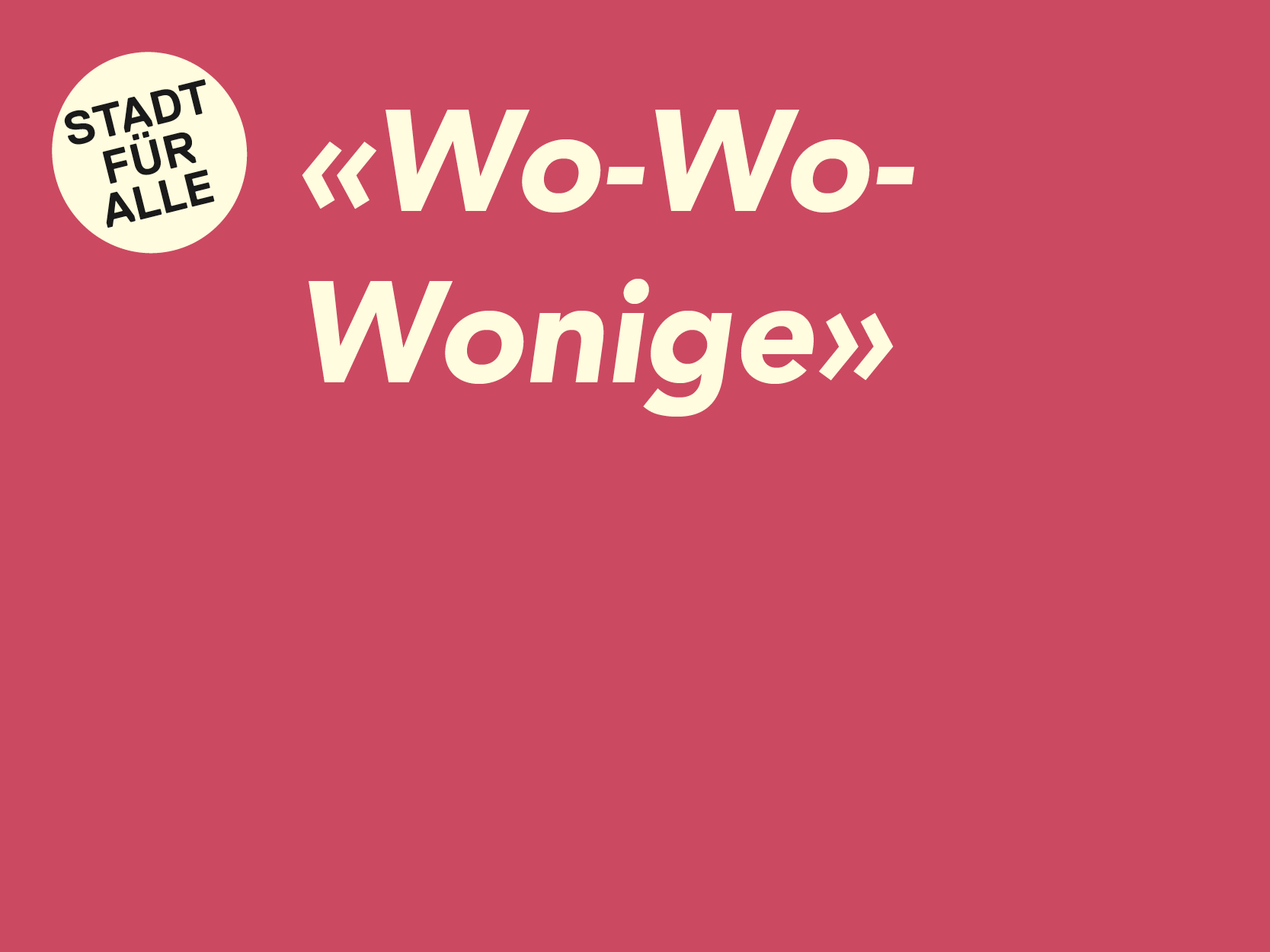«Wo-Wo-Wonige»
Der Slogan der Wohnungsnot-Bewegung der späten 80er-Jahre ist aktueller denn je. Am letzten Montag etwa auf der Titelseite des Tages-Anzeigers im Zusammenhang mit der Zürcher Wohndemo gegen Leerkündigungen à la Sugus-Häuser und überteuerte Mieten. Das Thema geht weit über Zürich und andere Städte wie Winterthur hinaus. In derselben Zeitungsausgabe wurde nachgewiesen, dass tiefe Leerstandsquoten auch ländliche Gemeinden erreicht haben. Etwa im Berner Oberland, wo selbst die Tourismus-Direktorin von Lenk-Simmental auf der Suche nach einer dauerhaften Wohnlösung noch nicht fündig wurde. Oder im Engadin, wo die Gemeinde Sils Genossenschafts-Wohnungen für Einheimische bauen will.
Zwei Tage zuvor war dem Landboten zu entnehmen, dass die Immobilienberatung Iazi aufgrund einer Erhebung im 2024 den stärksten Anstieg seit 20 Jahren bei den Bestandsmieten festgestellt hat: Um 4,5 Prozent stiegen im Durchschnitt schweizweit die Mieten bewohnter Wohnungen. Während der Anstieg in der Stadt Zürich 6,8 Prozent betrug, lag innerhalb der untersuchten Gemeinden im Kanton Zürich Wetzikon mit 12 Prozent überraschend an der Spitze.
Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Es geht aber um mehr als um Zahlen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Es verwundert deshalb nicht, dass neben fairen Löhnen, anständigen Renten und bezahlbaren Krankenkassenprämien das Thema Wohnen die Menschen in unserem Land am stärksten beschäftigt. Weil es ganz konkrete, oft einschneidende Auswirkungen auf ihren Lebensalltag hat. Das ältere Ehepaar, das nach Jahrzehnten ihre Wohnung aufgrund des bevorstehenden Neubaus verlassen muss und Mühe hat, eine Wohnung im Quartier zu finden, wo es sich heimisch fühlt und verwurzelt ist. Oder der ältere Herr, der nach dem Tod seiner Frau nicht mehr alleine in der Wohnung leben kann und sich deshalb für eine Wohnung mit Service im Brühlgut interessiert und mit seinem Sohn den Tag der offenen Tür Ende Februar besuchte.
Solche Beispiele werden zunehmen. Aufgrund des Sanierungsbedarfs der in die Jahre gekommenen Bausubstanz. Und aufgrund der demografischen Entwicklungen: bis im Jahr 2035 wird die Anzahl der Menschen in Winterthur, die 65 Jahre oder älter ist, von 20’000 auf 25’000 ansteigen. Weil dann auch jene, die in den späten 80er-Jahren «Wo-Wo-Wonige» gefordert haben, im Pensionsalter sind.
Nicolas Galladé, Stadtrat und Vorsteher Departement Soziales