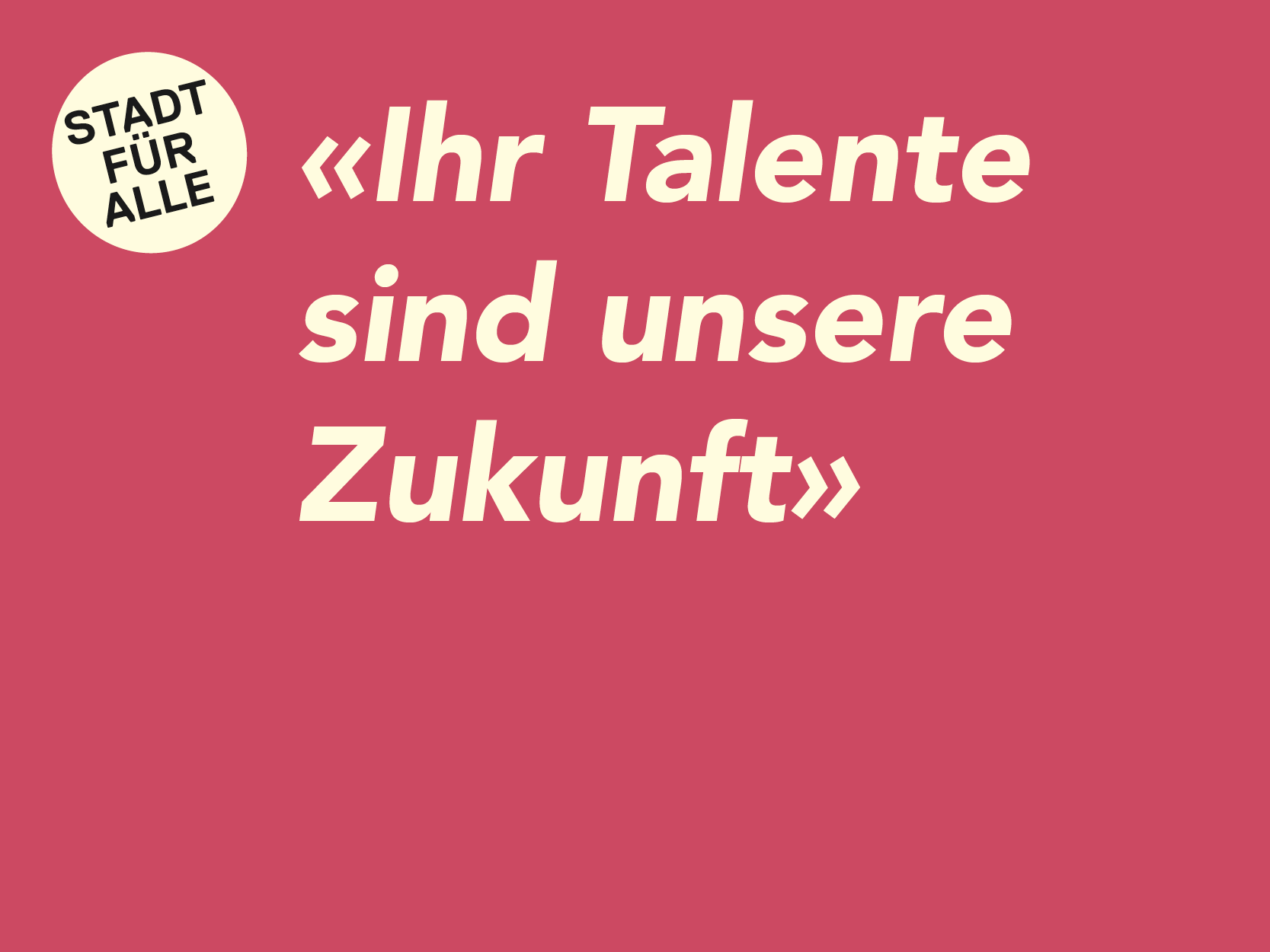Kinder mit Migrationsgeschichte: Ihre Talente sind unsere Zukunft
Wenn wir wollen, dass Kinder ihre Talente entfalten, brauchen sie eine sichere Existenz, frühe Förderung, formale und non-formale Bildung und nicht zuletzt: Partizipation. Wir brauchen darum Verbesserungen in der Asylfürsorge und Chancengerechtigkeit für alle Kinder, auch für jene mit Migrations- oder Fluchtgeschichte. Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, ihre Talente zu verschwenden.
Wer erfolgreiche Integrationsgeschichten sucht, schaut am besten Fussball. Wo lässt es sich besser zeigen, wie ehemalige Kinder mit Migrationshintergrund zu Idolen für breite Bevölkerungsschichten werden – und wie sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen? Kein Wunder, landete ich beim zentralen Thema meiner diesjährigen 1.-August-Rede bei unserer Fussball-Nationalmannschaft. Weil sie identitätsstiftend ist!
Während der Fussball-EM hatte ich das Gefühl, dass sie die Schweiz verbindet wie kaum etwas anderes. Von Genf bis Romanshorn, von Basel bis Chiasso haben so viele Menschen mitgefiebert, als die Schweiz mit einem frühen Tor gut ins Turnier startete, Deutschland an den Rand einer Niederlage brachte, Titelverteidiger Italien im Achtelfinale bezwang, und gegen England in Führung ging – und dann im Penaltyschiessen ausschied. Viele Menschen in der Schweiz haben diese Szenen und die Achterbahn der Gefühle im gleichen Moment auf ähnliche Weise erlebt. Unabhängig davon, ob Romand oder Deutschschweizerin, ob Städterin oder Bewohner einer Landgemeinde, ob SVPlerin oder SPler, ob arm oder reich.
Wenn ich von Fussball (und vielen anderen Sportarten) als «Integrationsmotor» spreche, so meine ich damit weit mehr als unsere Nationalmannschaft. Ich denke an die Quartierfussballvereine, die in meiner Heimatstadt Winterthur aktiv sind, wo der Teamsport ein aus- gezeichnetes Übungsfeld für Kinder und Jugendliche ist: Sie knüpfen vielfältige Beziehungen, lernen Fairplay und erleben ihre eigene Wirksamkeit. Solche Übungsfelder sind für benachteiligte oder gefährdete migrantische Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Aber auch allen anderen tun sie gut. Denn viele Perspektiven werden erst durch die non-formale Bildung ermöglicht – also durch Erfahrungen ausserhalb der Schule.
In Winterthur legen wir zum Beispiel Wert auf ein breites, niederschwelliges und partizipatives Angebot der offenen Jugendarbeit. Die Angebote werden mit und für die Nutzenden gestaltet, und benachteiligte Gruppen werden gezielt angesprochen. So erinnere ich mich gut an die strahlenden Kindergesichter in der Flüchtlingsunterkunft, als sie zum ersten Mal ein Velo ausprobieren durften. Das fördert nicht nur das Ver- trauen in die eigenen Fähigkeiten, sondern ermöglicht es später auch, der räumlichen Enge zu entfliehen und günstig mobil zu sein.
Wir wissen, was junge Menschen brauchen
Die Schweiz lebt von gelungenen Integrationsbiografien von jungen Menschen – nicht nur im Fussball. In Zukunft werden wir noch viel stärker auf sie angewiesen sein. Junge Menschen im Migrationskontext sind nicht nur unsere Fussballstars von morgen, sondern auch unsere Ärztinnen, unsere Handwerker, unsere Unternehmerinnen, unsere Forschenden, unsere Sozial- arbeitenden. Ihre Talente sind unsere Zukunft.
Eigentlich wissen wir, was es braucht, um Kinder und Jugendliche so zu fördern, dass sie ihre Talente entfalten können. Auch die entsprechenden verfassungsmässigen und gesetzlichen Grundlagen liegen vor. Die Bundes- verfassung räumt Kindern und Jugendlichen einen An- spruch auf «besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung» ein. Die UNO-Kinderrechtskonvention garantiert unter anderem das Recht auf Anhörung und Partizipation, das Recht auf Information, auf Gesundheit, auf Bildung und einen an- gemessenen Lebensstandard.
In Bezug auf Kinder mit einem Fluchthintergrund oder einer schwierigen Migrationsgeschichte geht unsere politische und gesellschaftliche Verantwortung weit über den Schutz zum Überleben hinaus. Das Ziel muss eine gesunde Entwicklung mit Perspektiven sein.
Handlungsbedarf beim Gesetzgeber
Leider sieht die Praxis nicht so aus. Bereits bei der blossen Existenzsicherung hapert es. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Charta Sozialhilfe über die materielle Situation von Kindern und Jugendlichen in der Sozialhilfe (Höglinger, Heusser & Sager 2024)* hat auch den Asyl- und Flüchtlingsbereich betrachtet. Gemäss Asylgesetz liegt der Unterstützungsansatz für Menschen mit Ausweis N, F oder S unter dem regulären Ansatz der Sozialhilfe. Zuständig für dessen Festlegung sind die Kantone und teilweise die Gemeinden, was zu massiven Unterschieden führt. Eine vierköpfige Familie erhält so je nach Wohnort eine zwischen 10 und 50 Prozent tiefere Grundpauschale, als von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) für die Sozialhilfe festgelegt ist. Die Studie hält fest, dass dies «sachlich kaum zu begründen» sei und «weder die Kürzung an sich noch der Umfang der Kürzung auf empirischen und wissenschaftlichen Grund- lagen» fusse. Sie zeigt auf, dass von der Asylfürsorge unterstützte Kinder «faktisch unter dem sozialen Existenzminimum leben», und konstatiert, «dies hat negative Auswirkungen auf das Kindeswohl und erschwert die gesellschaftliche Integration und Teilhabe».
Es ist ein Armutszeugnis für die Politik, wenn Kinder in Armut aufwachsen müssen. Die Städteinitiative Sozialpolitik setzt sich schon länger dafür ein, dass dieser Missstand behoben wird. Ihre Position: Geflüchtete Personen mit Schutzbedarf, von denen eine Integrationsleistung erwartet wird (also insbesondere vorläufig Aufgenommene und Personen aus der Ukraine mit Status S) sollten mit den Ansätzen der regulären Sozialhilfe unterstützt werden. Die Asylsozialhilfe ist dem sozialen Existenzminimum anzunähern, und die bestehende Rechtsungleichheit ist zu beheben.
Wenn wir wollen, dass Kinder ihre Talente entfalten, müssen wir dafür auch die Basis legen – eine sichere Existenz, frühe Förderung, formale und non-formale Bildung und nicht zuletzt: Partizipation. Es braucht Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen. Denn wir können es uns nicht leisten, ihre Talente zu verschwenden.
Nicolas Galladé, Stadtrat und Vorsteher Departement Soziales
*Höglinger, Dominic; Heusser, Caroline & Sager, Patrice. 2024. Die materielle Situation von Kindern und Jugendlichen in der Sozialhilfe. Im Auftrag der Charta Sozialhilfe. Bern: Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS.
Städteinitiative Sozialpolitik. 2024. Kinderrechte – Wie Städte die Rechte aller Kinder berücksichtigen können. Herbstkonferenz vom 13. September 2024 in Genf. https://staedteinitiative.ch/ de/Info/Konferenzthemen/Kinderrechte_(92024) (2.10.2024).